
© 2007 Warner Bros. Ent.
Das Beste kommt zum Schluss (2007)
The Bucket List
US-Drama von Rob Reiner mit Morgan Freeman und Jack Nicholson.User-Film-Bewertung:Filmsterne von 1 bis 5 dürfen vergeben werden, wobei 1 die schlechteste und 5 die beste mögliche Bewertung ist. Es haben insgesamt 13 Besucher eine Bewertung abgegeben.
Zwischen dem Großunternehmer und Milliardär Edward Cole (Jack Nicholson) und dem Mechaniker Carter Chambers (Morgan Freeman) liegen Welten. Am Scheideweg ihres Lebens teilen sie sich jedoch zufällig dasselbe Zimmer im Krankenhaus und entdecken dabei, dass sie zwei Dinge gemeinsam haben. Sie wünschen sich beide, ihre restliche Zeit so zu verbringen, wie sie es schon immer wollten, bevor sie "den Löffel abgeben", und beide wollen endlich herausfinden, wer sie eigentlich wirklich sind, um Frieden mit sich selbst schließen zu können.
Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, ihre Lebensfreude wieder zu entdecken. Dabei entwickelt sich nicht nur eine Freundschaft, sondern sie lernen auch, das Leben in vollen Zügen zu genießen - mit Einsicht und Humor. Und jedes neue Abenteuer bedeutet einen weiteren Haken auf ihrer To-do-Liste. Denn das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss…
Bildergalerie zum Film "Das Beste kommt zum Schluss"
Hier streamen
Filmkritik
Kick it like Freeman & Nicholson: Die beiden Schauspiel-Dinosaurier wollen’s noch mal wissen - als Krebspatienten ohne Heilungschancen machen sie einen drauf und arbeiten dabei eine Art letzte Wunschliste ab, die Titel gebende "Bucket List" [to kick the bucket = den Löffel abgeben], was übereifrig familienfreundlich als "Das Beste kommt zum Schluss" ins Deutsche übersetzt wurde.
Eine Komödie über das Sterben hat sich Rob Reiner damit vorgenommen, der Regisseur von "An Deiner Seite", "Wo die Liebe hinfällt" und "Harry und Sally", aber auch "Spinal Tap", "Stand By Me" und "Mysery". Und das funktioniert, wenn auch nur als routinierter Standard: Überraschungen gibt es keine. Nicholson spielt seine übliche Rolle –zynischer reicher Schürzenjäger – Freeman mimt ebenfalls sein Rollenklischee – den bescheidenen, rechtschaffenen, moralisch integren Durchschnitttypen. Dabei wär’s andersrum viel spannender gewesen: Warum nicht mal Freeman als dreist-charmanter Großkotz und Nicholson als bodenständiges Familienoberhaupt? Als unermesslich reicher Edward Cole ist Nicholson eine Art Karikatur des George Hanson aus "Easy Rider. Schnell noch ein paar Tatoos auf die erschlaffende Haut und im Rennwagen einmal tüchtig Gas geben. Statt das Land auf der Straße zu erfahren, hebt er ab und jettet um die Welt: Die beiden plötzlich erstaunlich fitten Alten konsumieren ein Stück Frankreich, kommen sich auf den (offensichtlich dem Computer enstammenden) Pyramiden von Gizeh näher und werden beim Taj Mahal auch noch tiefsinnig.
Die Moral des Ganzen? Mit viel Geld, Luxus und Kerosin kann man als Todkranker noch mal richtig leben. Damit dies nicht ganz so arg hedonistisch rüberkommt, nehmen die Krankenhausszenen vor dem Abhaken der Weltwunder sehr viel Filmzeit ein. Tatsächlich machen sie jedoch den besseren Teil aus – mit schwarzem Humor und einem erstaunlich uneitlen Nicholson, der sogar unter Narkose noch Biss zeigt. Im Gegensatz zum Regisseur, der sich – wohl um das finstere Thema ein wenig lieblicher zu gestalten – auf die gehabte Formel verlässt: Kitschige Familienzusammenführungen. Unansehlich ist der Film dennoch nicht, dank Nicholson und Freeman, die gekonnt gegen Sirup in den Dialogen und Schlaglöcher im Plot ankämpfen, was an sich schon einen gewissen Unterhaltungswert bietet. Als das, was er sein will – ein warmherziger Film über die reiche Vollendung eines Lebens im Angesicht des Todes – scheitert "Das Beste kommt zum Schluss" jedoch grandios.
Eine Komödie über das Sterben hat sich Rob Reiner damit vorgenommen, der Regisseur von "An Deiner Seite", "Wo die Liebe hinfällt" und "Harry und Sally", aber auch "Spinal Tap", "Stand By Me" und "Mysery". Und das funktioniert, wenn auch nur als routinierter Standard: Überraschungen gibt es keine. Nicholson spielt seine übliche Rolle –zynischer reicher Schürzenjäger – Freeman mimt ebenfalls sein Rollenklischee – den bescheidenen, rechtschaffenen, moralisch integren Durchschnitttypen. Dabei wär’s andersrum viel spannender gewesen: Warum nicht mal Freeman als dreist-charmanter Großkotz und Nicholson als bodenständiges Familienoberhaupt? Als unermesslich reicher Edward Cole ist Nicholson eine Art Karikatur des George Hanson aus "Easy Rider. Schnell noch ein paar Tatoos auf die erschlaffende Haut und im Rennwagen einmal tüchtig Gas geben. Statt das Land auf der Straße zu erfahren, hebt er ab und jettet um die Welt: Die beiden plötzlich erstaunlich fitten Alten konsumieren ein Stück Frankreich, kommen sich auf den (offensichtlich dem Computer enstammenden) Pyramiden von Gizeh näher und werden beim Taj Mahal auch noch tiefsinnig.
Die Moral des Ganzen? Mit viel Geld, Luxus und Kerosin kann man als Todkranker noch mal richtig leben. Damit dies nicht ganz so arg hedonistisch rüberkommt, nehmen die Krankenhausszenen vor dem Abhaken der Weltwunder sehr viel Filmzeit ein. Tatsächlich machen sie jedoch den besseren Teil aus – mit schwarzem Humor und einem erstaunlich uneitlen Nicholson, der sogar unter Narkose noch Biss zeigt. Im Gegensatz zum Regisseur, der sich – wohl um das finstere Thema ein wenig lieblicher zu gestalten – auf die gehabte Formel verlässt: Kitschige Familienzusammenführungen. Unansehlich ist der Film dennoch nicht, dank Nicholson und Freeman, die gekonnt gegen Sirup in den Dialogen und Schlaglöcher im Plot ankämpfen, was an sich schon einen gewissen Unterhaltungswert bietet. Als das, was er sein will – ein warmherziger Film über die reiche Vollendung eines Lebens im Angesicht des Todes – scheitert "Das Beste kommt zum Schluss" jedoch grandios.
Sira Brand
TrailerAlle "Das Beste kommt zum Schluss"-Trailer anzeigen
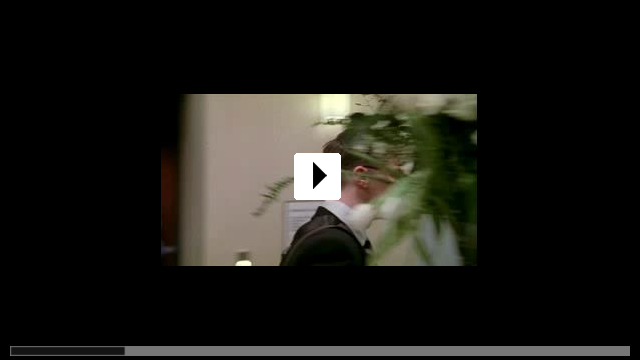
Besetzung & Crew von "Das Beste kommt zum Schluss"
Land: USAJahr: 2007
Genre: Drama
Originaltitel: The Bucket List
Kinostart: 24.01.2008
Regie: Rob Reiner
Darsteller: Sean Hayes, Rob Morrow, MaShae Alderman, Lauren Cohn, Morgan Freeman
Kamera: John Schwartzman
Verleih: Warner Bros.
Verknüpfungen zu "Das Beste kommt zum Schluss"Alle anzeigen

News
TV-Tipp für Mittwoch (19.1.): Morgan Freeman und Jack Nicholson stellen eine Liste auf
Kabel1 zeigt "Das Beste kommt zum Schluss"
Kabel1 zeigt "Das Beste kommt zum Schluss"







