
Monkeybone (2000)
In den USA kolossal gefloppte Komödie: Comiczeichner Brendan Fraser liegt nach einem Unfall im Koma und findet sich in einer bizarren Zwischenwelt mit seinen Kreaturen wieder. Pubertärer Klamauk, technisch brillant in Szene gesetzt...Kritiker-Film-Bewertung:User-Film-Bewertung:
Filmsterne von 1 bis 5 dürfen vergeben werden, wobei 1 die schlechteste und 5 die beste mögliche Bewertung ist. Es haben bislang 0 Besucher eine Bewertung abgegeben.
Das Leben könnte für den Comic-Zeichner Stu Miley kaum besser sein: er hat den Hit-Comic "Monkeybone" erfunden, der als Cartoon-Fersehserie in ganz Amerika laufen soll. Und er ist glücklich mit seiner hübschen Freundin Julie. Doch eines nachts hat Stu einen Unfall. Während sein Körper im Koma liegt, wandert sein Geist nach "Downtown", in eine Art Übergangsstation zwischen Leben und Tod. Downtown hat eine bizarre Landschaft und ist bevölkert von mystischen Göttern und Kreaturen, die die Alpträume der Lebenden heimsuchen. Stus´alter ego Monkeybone wird dort lebendig und sorgt für Ärger. Währenddessen muss sich Stu bemühen, den Tod auszutricksen- denn er muss schleunigst in die Welt der Lebenden zurückkehren, bevor die Ärzte die Beatmungsmaschine abstellen. Aber Monkeybone hat inzwischen eigene Pläne, die Stus´gefährden könnten...
Hier streamen
Filmkritik
Aus einer ungewöhnlichen und originellen
Idee macht "Monkeybone" eine banale
Geschichte, die den Kampf eines
Komikzeichners um die große Liebe gegen
seine eigene Kreation erzählt. Dabei hätte der
Stoff die Möglichkeit für Großes geboten. Eine
psychologische Reise durch die
Phantasiewelten des kreativen Genies in
Form von Alpträumen wäre möglich gewesen.
Statt dessen entschließt sich der Regisseur
die Ideen um die Komareise der
Belanglosigkeit zu opfern. Für den Charakter
des Comiczeichners und dessen Geschichte
spielt die Szenerie seiner Alpträume sowie
die Tatsache, dass er mit seiner eigenen
Kreation und damit einem anderen Teil von
sich selbst konfrontiert wird, letztlich keine
Rolle. Seine Alptraumwelt ist nur Kulisse für
einen Abenteuerplot. Nichts ist ein Zeichen
oder würde auf irgend etwas hindeuten. Damit
bleiben die Skurilitäten in herzloser
Selbstzweckhaftigkeit stecken. Sie sind kalt
kalkulierte Mahner eines Kinos der reinen
unverbundenen Ideenansammlung. Das wäre
ja noch erträglich, wenn neben dem
verschenkten Thema wenigstens das
konventionelle Geschehen spannend oder
amüsant in Szene gesetzt würde. Aber auch
dabei versagt "Monkeybone", wenn man eine
in einen Menschen gefahrene Comicaffenfigur
beobachten darf, die ständig geil ist, und zwar
auf Frauen sowie Geld. So plätschert die
Auseinandersetzung der beiden Hauptfiguren
Comiczeichner und sein Geschöpf) in einer
seltsamen Mischung aus Langeweile,
putzigen Szenerien, kleineren
Geschmacklosigkeiten und konventionellem
Balzkampf über die Runden. Damit wirkt
"Monkeybone" wie eine Lachsschnitte, die
irgendjemand glaubte, mit Tomatenketchup
veredeln zu müssen. Wohl bekomm’s.
Stefan Dabrock
TrailerAlle "Monkeybone"-Trailer anzeigen
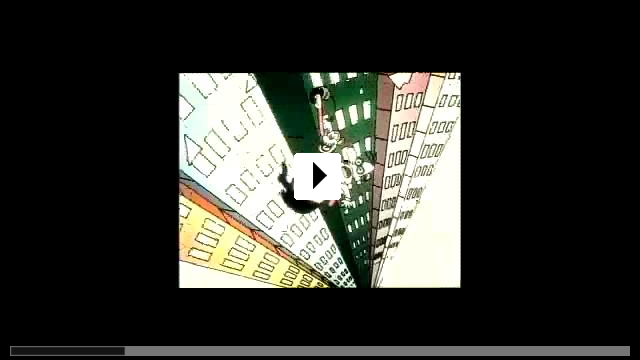
Besetzung & Crew von "Monkeybone"
Land: USAJahr: 2000
Genre: Fantasy
Länge: 92 Minuten
FSK: 12
Kinostart: 28.06.2001
Regie: Henry Selick
Darsteller: Rose McGowan, Bridget Fonda, Amy Higgins, Chris Kattan, Brendan Fraser
Kamera: Andrew Dunn
Verleih: 20th Century Fox
Verknüpfungen zu "Monkeybone"Alle anzeigen

Trailer