
The Man Who Wasn´t There (2001)
Nach dem farbgesättigten "O Brother, Where Art Thou?" nun eine Studie in Schwarzweiß. Die Coen Brothers erweisen dem Kriminalfilm der Vierziger mit diesem brillant gefilmten, aber leblosen Krimi mit Billy Bob Thornton ihre Reverenz...Kritiker-Film-Bewertung:User-Film-Bewertung:
Filmsterne von 1 bis 5 dürfen vergeben werden, wobei 1 die schlechteste und 5 die beste mögliche Bewertung ist. Es haben bislang 0 Besucher eine Bewertung abgegeben.
Eine kalifornische Kleinstadt, Ende der vierziger Jahre: Der schweigsame Barbier Ed Crane hadert mit der Monotonie seines Lebens. Unzufrieden mit Job und Ehe, scheint sich ihm plötzlich eine neue Chance zu bieten: Ein Kunde erzählt vom Erfolg seiner Trockenreinigung und bietet ihm an, mit 10 000 Dollar in das Unternehmen einzusteigen. Ed beschließt, das ihm fehlende Geld vom Kaufhausbesitzer Big Dave zu erpressen. Der hat ein Verhältnis mit Eds Frau. Doch Big Dave findet heraus, dass Ed der Erpresser ist...
Hier streamen
Filmkritik
Im eleganten Gewand des "Film Noir" widmet sich "The Man who wasn’t there" der Konsistenz des amerikanischen Jedermanns. Auf einem scheinbar abgegrasten Feld (der Wunsch des Durchschnittsbürgers nach einem anderen Leben) entfaltet sich nicht nur eine, in stimmungsvollen schwarz-weiss-Bildern erzählte, Hommage an Vorbilder aus den 50er Jahren, sondern eine philosophische Hinterfragung ihres gängigen Hauptfigurtypus. Konsequent steigert sich die Gewöhnlichkeit dieses Jedermanns bis zur Durchsichtigkeit. Er befindet sich zwar im Zentrum der Handlung, existiert quasi aber nicht, da ihn niemand bei seinem schändlichen Tun bemerkt. Ironischerweise wirft man ihm jedoch etwas vor, mit dem er nichts zu tun hat. So entwickelt sich ein tragikomisches Vexierspiel um eine Gesellschaft, in deren festgefügter Welt der Einzelne untergeht.
Redaktion
TrailerAlle "The Man Who Wasn´t There"-Trailer anzeigen
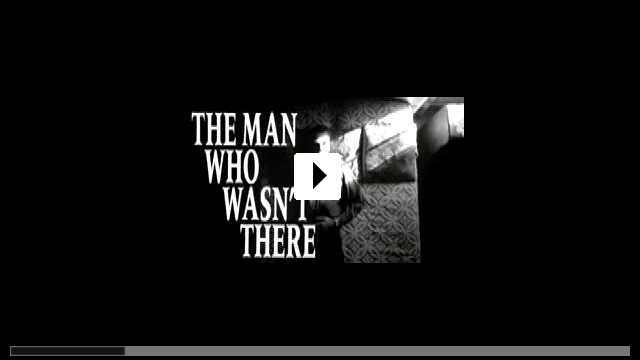
Besetzung & Crew von "The Man Who Wasn´t There"
Land: USAJahr: 2001
Genre: Drama
Länge: 116 Minuten
Kinostart: 08.11.2001
Regie: Joel Coen
Darsteller: James Gandolfini, Tony Shalhoub, Katherine Borowitz, Billy Bob Thornton, Frances McDormand
Kamera: Roger Deakins
Verleih: Constantin Film
Verknüpfungen zu "The Man Who Wasn´t There"Alle anzeigen

In Manhattan wird wieder gedreht
